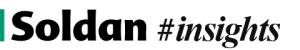Der Gesetzgeber steht unter dem Druck, das anwaltliche Berufsrecht zu modernisieren. Das gilt insbesondere für die interprofessionelle Zusammenarbeit zwischen Rechtsanwälten und anderen Berufsgruppen. Anfang 2016 hat das Bundesverfassungsgericht das weitgehende Verbot für teilweise verfassungswidrig erklärt und den Zusammenschluss von Rechtsanwälten mit Apothekern und Ärzten erlaubt. Im Rahmen seiner Befragungen zum Berufsrechtsbarometer hat Prof. Dr. Matthias Kilian, Direktor des Soldan Instituts, auch untersucht, wie sich Anwälte die künftige Zusammenarbeit mit anderen Berufen wünschen. Danach plädierten 34 Prozent der insgesamt 2.318 befragten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte für die Beibehaltung des aktuellen Status Quo, nach dem eine gemeinsame Berufsausübung über Notare, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer hinaus nur mit Ärzten und Apothekern möglich ist. 22 Prozent befürworten hingegen eine Zusammenarbeit mit Angehörigen aller verkammerten Freiberufe, 18 Prozent mit Angehörigen beliebiger freier Berufe. Weitere 20 Prozent könnten sich eine Zusammenarbeit mit freien und gewerblichen Berufen vorstellen, die ein Anwalt im Zweitberuf ausüben darf, und 6 Prozent würden eine uneingeschränkte Liberalisierung begrüßen.
Darüber hinaus werden auch Reformen anderer berufsrechtlicher Regelungen immer wieder vehement diskutiert. Das trifft zum Beispiel auf die derzeitige Regelung der Interessenkonflikte zu. „Der Paragraf 43 IV BRAO birgt eine hohe Rechtsunsicherheit für Rechtsanwälte. Im Rechtsvergleich ist die Lösung unüblich und stellt vor allem ein Problem für internationale Kanzleien dar“, sagte Kilian bei der Präsentation seiner Befragungen auf dem Deutschen Anwaltstag. So gab immerhin ein Drittel an, dass sie innerhalb der vergangenen drei Jahre zwischen drei und fünf Mandaten aufgrund von Interessenkonflikten ablehnen mussten.
Manche Aufregung im Zuge von Reformdiskussionen erscheint vor dem Hintergrund empirischer Befunde in einem anderen Licht: Die Einführung einer konkretisierten Fortbildungspflicht von 40 Stunden im Jahr, über die im Zuge der kleinen BRAOReform 2017 leidenschaftlich gestritten und die dann im Ergebnis aber verworfen wurde, hätte nur wenige Rechtsanwälte nachhaltig betroffen. So gaben 61 Prozent der Befragten an, dass ihr bisheriges Fortbildungsverhalten den Anforderungen genügt hätte, viele weitere Rechtsanwälte hätten ihr Fortbildungsengagement zum Beispiel durch Selbststudium nur geringfügig ausweiten müssen. „Angesichts der Bedenken, die die Europäische Kommission perspektivisch gegen das wegen hoher Ausbildungshürden und fehlender Fortbildungspflichten inkohärente Berufsbildungskonzept deutscher Rechtsanwälte vorbringen dürfte, ist eine Chance zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Anwaltschaft versäumt worden“, so Kilian. Eher ablehnend äußerten sich die Studienteilnehmer zu anderen heißen Eisen des anwaltlichen Berufsrechts: So plädierten 65 Prozent dafür, das berufsspezifische Werberecht beizubehalten. Auch die Lockerung des Provisionsverbotes, das durch das vermehrte Auftreten von Legal Tech-Anbietern, die mit Anwaltskanzleien zusammenarbeiten, ein neues Anwendungsfeld gewonnen hat, lehnte mit 74 Prozent die große Mehrheit der Anwälte ab.
Allerdings stehen jüngere Anwälte den meisten Reformfragen viel aufgeschlossener gegenüber. Nach den Worten Kilians wird sich der Gesetzgeber entscheiden müssen, ob er sich bei seinen Reformen an den älteren Kollegen orientiert oder an den jüngeren, die noch viele aktive Berufsjahre vor sich haben werden.